
Cannabis aus der Apotheke
Willkommen bei Grüne Blüte - Pharmazeutisch geprüftes Cannabis aus Ihrer Apotheke!
Einfach Cannabis-Medikament auswählen, Rezept hochladen und zur Haustür geliefert bekommen.
-

Große Produktauswahl im Live Bestand
-

Beratungsqualität aus der Apotheke
-

Schneller & kostenfreier Versand
So einfach geht's
Im Upload-Bereich können Sie ganz bequem Ihr gültiges Cannabisrezept als Scan oder Foto hochladen. Um eine problemlose Kommunikation zu ermöglichen, hinterlegen Sie dort außerdem eine Telefonnummer und E-Mail-Adresse.
-

Rezept hochladen
-

Unverbindliches Angeboterhalten
-
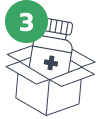
Medikamente innerhalb von 1-2 Tagen nach Zahlung erhalten
In 3 Schritten Cannabispatient:in werden
-

Behandlung anfragen
Behandlung anfragen: Stelle eine Anfrage zur Behandlung und fülle den Fragebogen digital von zu Hause aus. Anhand deiner Antworten sowie Nachweise wird vorab eingeschätzt, ob eine Behandlung mit medizinischem Cannabis (THC) für dich in Frage kommen könnte.
-

Medizinisches Screening
Die Ärzt:innen auf der Plattform werten kostenlos deine Daten aus und melden sich bei eventuellen Rückfragen. Nach der Prüfung wird dein Rezept direkt ausgestellt.
-

Einreichen des Rezepts in der Apotheke
Nach Prüfung der Angaben und Ausstellung des Rezepts, kannst Du Dir das Rezept entweder nach Hause zuschicken lassen oder alternativ bei der Apotheke einlösen und das Medikament, je nach Verfügbarkeit, direkt nach Hause geschickt bekommen.
Produkte auswählen und einfach Rezept hochladen
Laden Sie ganz einfach Ihr Rezept online hoch. Anschließend erhalten Sie umgehend eine Rückmeldung zu Ihrem Rezept und dem Bestellvorgang. Sollten Sie Fragen haben oder Hilfe benötigen, rufen Sie uns gerne unter der +49 34927 723100 an.
Gütesiegel & Mitgliedschaften
Alle Fragen rund um Cannabis
Cannabis Apotheken FAQ
Wie kann ich mein Cannabisrezept online einlösen?
Sie können Ihr Cannabisrezept bei uns einfach und schnell online per Scan oder Foto einlösen. Folgen Sie dazu bitte den Anweisungen unter der Rubrik Rezept einlösen.
Rezept als Scan oder Foto elektronisch hochladen und übermitteln. Damit können wir schon vorab Ihre Bestellung bearbeiten und den Versand vorbereite...
Welche Möglichkeiten zur Bezahlung stehen mir zur Verfügung?
Bei einer Bestellung von Cannabis-Arzneimitteln senden Sie uns bitte den Betrag per Vorkasse oder vorab über das SEPA-Lastschriftverfahren auf unser Konto. Wir bieten zusätzlich auch die direkte Abrechnung mit Ihrer (privaten) Krankenkasse an.
Kann ich Cannabisprodukte auch ohne Rezept bestellen?
Cannabinoidhaltige Arzneimittel gehören zu den verschreibungspflichtigen Betäubungsmitteln.
Eine erfolgreiche Bestellung ist daher nur mit Vorlage eines gültigen Originalrezeptes möglich. Lesen Sie hier, welche Möglichkeiten es gibt, Cannabis auf Rezept verschrieben zu bekommen.
Wie funktioniert der Versand von Cannabisprodukten?
Wir tun unser Bestes, Ihren Auftrag so schnell wie möglich zu bearbeiten. Um das möglich zu machen, werden Sie beim Einlösen des Rezepts gebeten, bereits im Vorfeld eine Kopie des Originalrezepts hochzuladen. Dieses kann dann von einem Mitarbeitenden auf Richtigkeit überprüft werden.
Sie erhalten nach erfolgreicher Prüfung im Anschluss außerdem ein Angebot von uns, n...

Cannabis als Medizin: Das sind die Fakten!
Die medizinische Verwendung von Hanf hat Tradition. Die Pflanze findet schon seit langer Zeit sowohl als Rauschmittel, wie auch als Heilmittel Verwendung. Auch im Internet findet man heute etliche Erfahrungsberichte zum Nutzen von Cannabis in der Medizin. Es kursieren viele Mythen. Manche preisen es als Wundermittel. Doch was ist wahr? Hier erfahren Sie alles zum Thema: Cannabis in der Medizin – was sagt die Forschung?

Cannabis Legalisierung - zwischen Medizin und Droge
Können Sie sich Ihre Chefin oder den Nachbarn von gegenüber beim Rauchen eines Joints vorstellen? Eher nicht? Dabei ist das, rein statistisch gesehen, gar nicht unwahrscheinlich. Mehr als jede:r vierte Deutsche hat sich schon einmal eine Cannabiszigarette genehmigt oder zumindest daran gezogen. Bei einer Befragung für den Epidemiologischen Suchtsurvey 2018 gaben 3,7 Millionen Bundesbürger:innen an, in den letzten zwölf Monaten Cannabis konsumiert zu haben. Nach wie vor ist Cannabis mit Abstand die am häufigsten konsumierte illegale Droge. Und nachdem andere Länder vorgelegt haben, werden auch in Deutschland die Stimmen nach einer Legalisierung von Cannabis wieder lauter. Warum ist Cannabis nicht gleich Cannabis – und was spricht für oder gegen eine Legalisierung von Cannabis zu Genusszwecken in Deutschland?
Ratgeber
In unserem Ratgeber werden alle Fragen rund um das Thema medizinisches Cannabis beleuchtet.
-

Cannabis und Alkohol: Was passiert beim Mischko...
Von multiplem Substanzgebrauch – umgangssprachlich: Mischkonsum – spricht man, wenn eine Person mehrere psychoaktive Substanzen in einem kurzen Zeitrahmen konsumiert, sodass sich deren Wirkungen überlappen. Dazu gehört das sogenannte „Crossfading“,...
Cannabis und Alkohol: Was passiert beim Mischko...
Von multiplem Substanzgebrauch – umgangssprachlich: Mischkonsum – spricht man, wenn eine Person mehrere psychoaktive Substanzen in einem kurzen Zeitrahmen konsumiert, sodass sich deren Wirkungen überlappen. Dazu gehört das sogenannte „Crossfading“,...
-

Cannabis Decarboxylierung: Wie die Aktivierung ...
„Cannabis decarboxylieren“ mag im ersten Moment kompliziert klingen. Tatsächlich hat das aber jede:r schon einmal gemacht, der oder die sich schon einmal einen Joint angezündet hat – in der Regel...
Cannabis Decarboxylierung: Wie die Aktivierung ...
„Cannabis decarboxylieren“ mag im ersten Moment kompliziert klingen. Tatsächlich hat das aber jede:r schon einmal gemacht, der oder die sich schon einmal einen Joint angezündet hat – in der Regel...
-

Epilepsie und Cannabis: Der aktuelle Stand der ...
Könnte zur Behandlung von Epilepsie Cannabis geeignet sein? In Fachkreisen eine viel diskutierte Frage. Von der europäischen Arzneimittel-Agentur (EMA) wurde bisher ein CBD-Präparat für die Therapie bei Epilepsie zugelassen –...
Epilepsie und Cannabis: Der aktuelle Stand der ...
Könnte zur Behandlung von Epilepsie Cannabis geeignet sein? In Fachkreisen eine viel diskutierte Frage. Von der europäischen Arzneimittel-Agentur (EMA) wurde bisher ein CBD-Präparat für die Therapie bei Epilepsie zugelassen –...











